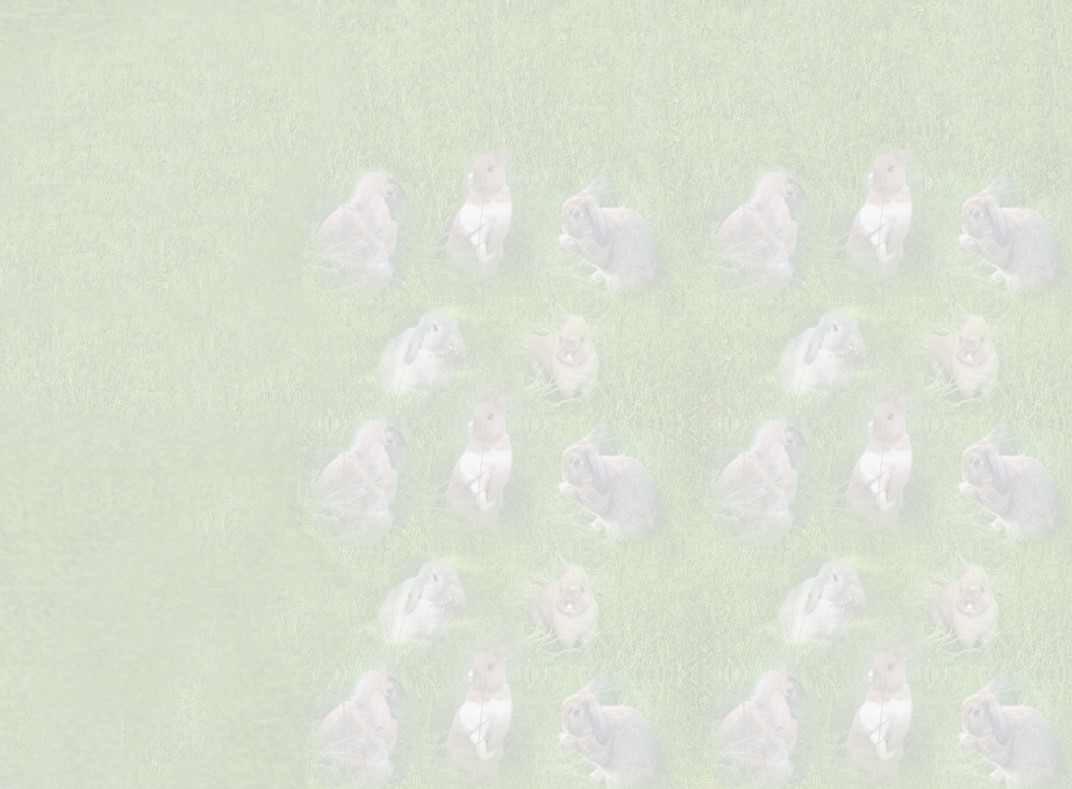Augenerkrankungen beim Kaninchen
Das Auge ist ein sehr empfindliches Organ. Bereits kleine Reize können heftige Reaktionen auslösen und massiv schmerzhaft sein. Daher müssen Auffälligkeiten immer ernst genommen und schnellstmöglich abgeklärt werden.
Allgemeines
Ursachen für Augenveränderungen
Augensymptome können primär oder sekundär (infolge einer anderen Erkrankung) auftreten. Als Ursachen kommen infrage:
- Verletzung (Kratzer, Stoß, Fremdkörper etc.)
- Vernarbung
- Reizung (durch Staub, Zigarettenrauch, Hygienemangel, Haare, ...)
- Schnupfenerreger
- Verlegung des Tränen-Nasen-Kanals (Sekret, Fremdkörper etc.)
- Zahnerkrankung
- E. cuniculi-Infektion
- altersbedingte Linsentrübung
- Missbildung
- Herzerkrankung, Thymom
Symptome einer Augenerkrankung
Ein Augenproblem kann sich anhand verschiedener Symptome äußern:
- gerötete Bindehäute
- gerötete Skleren
- Schwellungen der Lid- und Bindehäute
- Tränenfluss (Epiphora) - klar oder trüb
- Zukneifen (Blepharospasmus)
- Lichtempfindlichkeit (Photophobie)
- Trübungen
- flockige oder fädenziehende weiße Strukturen innerhalb der Linse
- Nickhautvorfall
- sichtbare Schädigung der Hornhaut
- Exophthalmus (Hervortreten des Augapfels)
Therapie einer Augenerkrankung
Abhängig von der Art der Erkrankung und der Ursache kommen folgende Therapieoptionen infrage:
- befeuchtende Augenpräparate (Tropfen oder Gele)
- antibiotische Augentropfen
- regenerationsfördernde Augenpräparate
- sekretlösende Augentropfen
- entzündungshemmende Augentropfen (kein Cortison!)
- drucksenkende Augentropfen
- pupillenerweiternde Augentropfen (Mydriaka)
- systemisches Schmerzmittel
- Spülung des Tränen-Nasen-Kanals
- Behandlung der Allgemeininfektion
- Fenbendazol gegen E. cuniculi
- Entfernung der reizenden Haare / des Fremdkörpers
- Verbesserung der Umgebungsluft
- Abfräsen der Hornhaut + Kontaktlinse
- Augen-OP
- Zahnsanierung
- Behandlung der Herzerkrankung / des Thymoms
Lidfehlstellung beim Kaninchen
Das Hauptproblem einer Lidfehlstellung besteht darin, dass sie oftmals einen chronischen Reiz für die Hornhaut darstellt. Mögliche Folgen sind ein Fremdkörpergefühl, Schmerzen, Entzündungen und Verletzungen.Ursachen einer Lidfehlstellung
- angeborene Fehlstellung
- Verletzung
- Entzündung
Diagnostik bei Lidfehlstellung
- Adspektion (Betrachtung)
Katarakt (Grauer Star, Linsentrübung) beim Kaninchen
Eine Katarakt ist eine Trübung der Augenlinse.
Ursachen von Grauem Star
- hohes Alter
- E.-cuniculi-Infektion
- (Diabetes mellitus)
Symptome bei Grauem Star
- fortschreitende Trübung der Augenlinse
- Bei Enzephalitozoonose: möglicherweise neurologische Ausfallerscheinungen
- Bei Diabetes mellitus: Gewichtsverlust, Heißhunger, vermehrter Durst, vermehrter Harnabsatz
Diagnostik bei Grauem Star
- Adspektion (Betrachtung)
- Spaltlampenuntersuchung
- Blutuntersuchung (E. cuniculi, Fruktosamin)
Therapie von Grauem Star
- Bei positivem EC-Status: Fenbendazol, Infusionen; ggf. B-Vitamine und Antibiose
- Bei Diabetes mellitus: Fütterungsoptimierung, Insulin
- Haltungsanpassung
Konjunktivitis (Bindehautentzündung) beim Kaninchen
Ursachen einer Konjunktivitis
- verlegter / entzündeter Tränen-Nasen-Kanal
- Infektionserreger (z. B. Schnupfenerreger, Myxomatosevirus)
- Verletzung
- Reizung (durch Haare, Rauch, Staub, Hygienemangel, ...)
Therapie einer Konjunktivitis
Abhängig von der Ursache kommen verschiedene Therapiemethoden infrage:
- Schmerzmittel
- befeuchtende Augenpräparate (Tropfen, Gel, (Salben))
- antibiotische Augentropfen
- sekretlösende Augentropfen
- Spülung des Tränen-Nasen-Kanals
- Behandlung der Allgemeininfektion
- Entfernung der reizenden Haare / des Fremdkörpers
- Verbesserung der Umgebungsluft
- Zahnsanierung
Hornhautverletzungen und Hornhautentzündung (Keratitis) beim Kaninchen
Die Keratitis beschreibt eine Entzündung der Hornhaut (Cornea).
Ursachen einer Keratitis
- Verletzung (z. B. durch Kralle, Gegenstand, Fremdkörper)
- mechanische Reizung (z. B. durch Haare)
- stumpfes Trauma (z. B. Stoß, Tritt)
- sekundär durch übergreifende Entzündung (z. B. vom Tränen-Nasen-Kanal)
Uveitis beim Kaninchen
Eine Uveitis ist der Oberbegriff für Entzündungen der mittleren Augenhaut (Uvea). Eine Sonderform stellt die phakoklastische Uveitis dar, welche separat beschrieben wird (s. u.).
Ursachen einer Uveitis
- Trauma, Verletzung
- Allgemeininfektion
- phakoklastische Uveitis (s. u.)
Phakoklastische Uveitits beim Kaninchen
Die phakoklastische Uveitis stellt eine Sonderform der Uveitis beim Kaninchen dar.
Ursache einer phakoklastischen Uveitis
- Infektion mit E. cuniculi im Mutterleib
Therapie bei phakoklastischer Uveitis
- Fenbendazol
- lokale Antibiose
- pupillenerweiternde Augentropfen (Mydriaka)
- entzündungshemmende Augentropfen
- antibiotische (tetrazyklinhaltige) Augentropfen
- Schmerzmittel
- Phakoemulsifikation (Entfernung der Linse)
- Bulbusenukleation (Entfernung des Augapfels)
Glaukom beim Kaninchen
Ein Glaukom bezeichnet einen erhöhten Augeninnendruck. Dieser kommt zustande, wenn mehr Kammerwasser produziert wird, als abfließen kann. Beim gesunden Auge fließt das Kammerwasser ungehindert über den Kammerwinkel ab. Ursache eines Glaukoms
- Primärglaukom: Missbildung
- Sekundärglaukom: Verlegung des Kammerwinkels, z. B. durch Uveitis-bedingte Verklebungen
Nickhautdrüsenvorfall / Nickhautdrüsenhyperplasie beim Kaninchen
Eine Hyperplasie (Vergrößerung) der Nickhäute hat zur Folge, dass sie vorfallen und im inneren Augenwinkel sichtbar werden.
Ursache einer Nickhautdrüsenhyperplasie
Einseitiger Nickhautvorfall:
- Verletzung
- Trauma
Beidseitiger Nickhautvorfall:
- Veranlagung
- Infektionskrankheit
- Bluthochdruck
- reizende Umgebungsluft