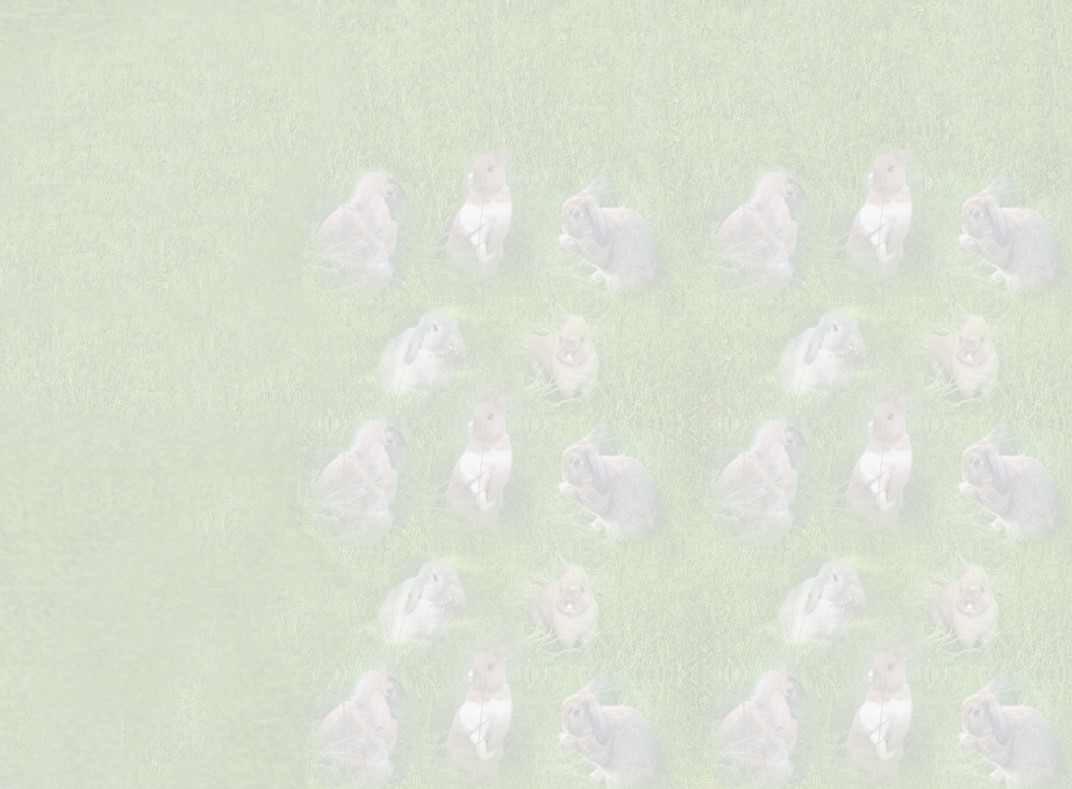Schmerztherapie
Eine adäquate Schmerzbehandlung ist absolut unerlässlich, um den Teufelskreis Schmerzen - verminderte Darmmotorik - Gasbildung - noch stärkere Schmerzen zu durchbrechen.
Das Schmerzmittel erster Wahl ist Metamizol (4-6x tgl. 50 mg / kg oder 4x tgl. 75 mg / kg p. o., s. c. oder i. v.). Bei hochgradigen Aufgasungen kann der Tierarzt zusätzlich Butorphanol (4-6x tgl. 0,4 mg / kg s. c., i. m. oder i. v.) oder Buprenorphin (3x tgl. 0,01-0,05 mg / kg s. c., i. m. oder i. v) geben.
Meloxicam ist bei Aufgasungen nicht geeignet!
Antitympanikum
Aufgegaste Kaninchen werden mit einem Antitympanikum gegen schaumige Gasbildung versorgt. Dieses führt zwar nicht zur Auflösung des Gases, jedoch verkleinert es die Gasblasen, wodurch sie leichter abtransportiert und ausgeschieden werden können.
Geeignet ist Dimeticon oder Simeticon. Bei hochgradigen Aufgasungen kann alle 1-2 Stunden 1 ml / kg p. o. eingegeben werden.
Prokinetikum
Ein Prokinetikum (i. d. R. Metoclopramid, z. B. Emeprid®) verfolgt zwei Ziele: Erstens stimuliert es die Magenmuskulatur, um den Weitertransport des Nahrungsbreis und somit auch den Abtransport des Gases zu fördern. Zweitens wirkt es übelkeitshemmend und appetitanregend. Je früher ein aufgegastes Kaninchen wieder selbstständig frisst, umso besser ist die Prognose!
Metoclopramid wird über 3 Tage 3x täglich in einer Dosierung von 0,5 mg / kg oral oder subkutan gegeben. Bei einer Verstopfung, Stase, einer Darmlähmung oder einem Darmverschluss sollte die erste Dosis mit 5 mg / kg, also zehnmal höher, dosiert werden und nicht oral eingegeben, sondern gespritzt werden.
Im Falle von Durchfall sollte hingegen abgewogen werden, ob ein Prokinetikum sinnvoll ist: Durch den schnellen Vorwärtstransport des Nahrungsbreis wird im Dickdarm weniger Flüssigkeit resorbiert. In der Folge wird die Kotkonsistenz mitunter noch flüssiger. Dies ist bei starken Aufgasungen das kleinere Übel; bei nur geringgradigen Blähungen und gleichzeitig starkem Durchfall hingegen wird tendenziell eher auf die Anwendung von Prokinetika verzichtet.
Antiemetikum
Antiemetika sind übelkeitshemmende Medikamente. Soll ein Kaninchen kein Metoclopramid (mehr) bekommen (welches ebenfalls eine antiemetische Wirkung hätte) oder ist dies von der Wirksamkeit her nicht ausreichend, kann stattdessen oder zusätzlich Maropitant (z. B. Prevomax®) in einer Dosierung von 1x tgl. 1 mg / kg verwendet werden. Zusätzlich zur übelheitshemmenden hat es auf den Magen-Darm-Trakt auch eine antientzündliche und prokinetische (motorikstimulierende) Wirkung.
Wird Cerenia® gespritzt, sollte es in ein kleines Infusionsdepot (z. B. 5-10 ml NaCl oder RiLac) injiziert werden, da es ansonsten stark brennt. Bei Prevomax® scheint dies nicht der Fall zu sein.
Antibiotika
Antibiotika sind bei einer bakteriellen Infektion erforderlich. Eine solche liegt z. B. vor, wenn der Blinddarm hochgradig aufgegast ist, wenn das Kaninchen matschig-flüssigen, schleimigen oder blutigen Kot absetzt, Fieber (> 39,5° C) oder eine sogenannte Pseudo-Linksverschiebung (= prozentual mehr Neutrophile Granulozyten als Lymphozyten) im Blutbild hat.
Auch, wenn im Ultraschall eine chronische Darmentzündung nachgewiesen wird, kommen Antibiotika zum Einsatz.
Als alleinige Therapiemaßnahme oder als Therapie ohne Ursachenabklärung sind Antibiotika keinesfalls geeignet! Außerdem muss in jedem Fall ein darmfreundliches Antibiotikum mit vorwiegend gram-positivem Wirkspektrum verwendet werden.
Meist werden Enrofloxacin (2x tgl. 10 mg / kg p. o., s. c. oder i. v.; z. B. Orniflox®, Baytril®, Enrotron®) und Metronidazol (2x tgl. 20 mg / kg p. o., z. B. Eradia®, oder 5 mg / kg i. v. mit Metronidazol-Infusionslösung) in Kombination eingesetzt.
Auch, wenn bereits eine Sepsis (Blutvergiftung) vorliegt oder der Verdacht auf eine solche besteht, sind Antibiotika potenziell lebensrettend. Eine Sepsis kann auftreten, wenn die Blut-Darm-Schranke in Folge der gasbedingten Druckbelastung durchlässig für Darmbakterien geworden ist oder wenn die Darmschleimhäute direkt durch einen Erreger geschädigt wurden. Eine (intravenöse) Doppel-Antibiose ist dann die einzige Möglichkeit, das Kaninchen noch zu retten.
Pro- und Präbiotikum
Pro- und Präbiotika (z.B. Apfelpektin, OmniBiotic10®, PrePreBac®) sind im Falle einer Darmproblematik immer hilfreich, um die gutartige Darmflora zu unterstützen.
Präbiotika wie Pektine enthalten Fasern, von welchen sich die gutartigen Darmbakterien ernähren. Probiotika (z. B. ProPreBac®, OmniBiotic10®) hingegen enthalten die Bakterien selbst. Hier erfahren Sie mehr zur Anwendung und Dosierung.
B-Vitamine
Hochgradige Aufgasungen sowie flüssiger oder schleimiger Kot deuten auf eine schwere Entgleisung der Darmflora hin, welche für die Produktion der B-Vitamine zuständig ist. In einem solchen Fall ist es sinnvoll, dem Kaninchen vorübergehend einen Vitamin-B-Komplex zuzuführen.
Gut geeignet sind zum Beispiel Rodicare Vita B® (1x tgl. 0,5 ml / kg p. o.) zur oralen Verabreichung oder Ampullen aus der Humanmedizin zur subkutanen Verabreichung. Wird Vitamin B gespritzt, sollte es in ein kleines Infusionsdepot injiziert werden, da es ansonsten stark brennt.
Infusionen
Infusionen zur Kreislaufstabilisierung sind bei hochgradigen Aufgasungen potenziell lebensrettend! Sehr schwache Kaninchen sowie Tiere mit Untertemperatur müssen vom Tierarzt stationär aufgenommen und intravenös infundiert, also an den Tropf gehängt werden.
Unter die Haut gespritzte Infusionen sind bei einer bereits vorhandenen Kreislaufschwäche (d. h. bei deutlicher Untertemperatur oder einem stark gestörten Allgemeinbefinden) schlecht bis gar nicht wirksam! Durch die eingeschränkte periphere Durchblutung wird das verabreichte Flüssigkeitsdepot in diesem Fall nicht oder nur sehr langsam resorbiert!
Hier finden Sie ausführliche Informationen zum Thema Infusionen.
Catosal®
Bei Kreislaufschwächen aller Art hat sich Catosal® (1x tgl. 1 ml / kg s. c.) bewährt. Es kurbelt verschiedene Stoffwechselprozesse an und trägt zur Stabilisierung des Kreislaufs bei.
Huminsäuren
Huminsäuren kleiden die Darmschleimhaut schützend aus, fördern ihre Regeneration und hemmen die Resorption von Giftstoffen. Die empfohlene Dosierung beträgt 2x tgl. 1 g / kg p. o..
Um die Dosierung und Eingabe zu erleichtern, können Pulverpräparate in Wasser aufgelöst werden. Huminsäuren sollten immer mindestens 30 Minuten zeitversetzt zu anderen oralen Medikamenten verabreicht werden, da sie ihre Resorption beeinträchtigen können!
Wärme
Wärmezufuhr ist bei Untertemperatur überlebenswichtig. Unterkühlte Kaninchen sollten immer in einer Box untergebracht werden, in der sie warmgehalten werden können.
Hierzu können Sie dem Kaninchen beispielsweise Wärmflaschen oder Wärmekissen, die in der Mikrowelle aufgewärmt werden, in die Box legen. Decken Sie das Kaninchen und das Wärmedepot zusammen mit einer Decke zu, damit sich die Wärme besser staut. Achten Sie darauf, dass die Wärmequelle nicht so heiß ist, dass sie bei direktem Kontakt Verbrennungen verursachen könnte.
Auch mit warmem Wasser gefüllte Handschuhe sind ein gutes Wärmedepot. Sie können jedoch leicht durch Krallen oder Zähne beschädigt werden. Durch das auslaufende Wasser wird das Tier dann durchnässt und unterkühlt noch stärker.
Weiterhin ist es möglich, die Box auf eine elektrische Heizmatte zu stellen oder eine Rotlichtlampe oder einen Heizlüfter in ausreichender Entfernung (!) auf die Gittertür der Box zu richten. Bei diesen Vorgehensweisen ist allerdings absolute Vorsicht geboten, da das Kaninchen der Wärme nicht ausweichen und somit leicht überhitzen kann.
Kontrollieren Sie zu Beginn alle 15 Minuten die Körpertemperatur und halten Sie Ihre Hand neben das Kaninchen in die Box, um zu prüfen, wie viel Wärme dort ankommt.
Diätkost
Bieten Sie dem Kaninchen bei starken Aufgasungen ausschließlich Schonkost an. Dazu gehören das gewohnte, rohfaserhaltige Grünfutter (Wiesen- oder Küchenkräuter, Blattgemüse, Gräser, Zweige) sowie Heu. Als Getränk haben sich - zusätzlich zum Wasser - Fenchel- und Kümmeltee bewährt, da sie krampflindernd wirken.
Laktulose
Als Abführmittel beschleunigt Laktulose den Transport des Nahrungsbreis durch den Magen-Darm-Trakt. Somit hilft sie auch dabei, Gas schneller abzutransportieren. Im Falle einer Vergiftung, einer Verstopfung oder eines Darmverschlusses gehört Laktulose ebenfalls zu den essenziellen Therapiemaßnahmen.
Je nach Schweregrad der Aufgasung wird Laktulose mindestens dreimal täglich und maximal einmal pro Stunde eingegeben (1-2 ml / kg p. o.).
Zwangsfütterung
Eine Zwangsfütterung ist bei Kaninchen notwendig, die nicht von selber fressen und bei denen ein Darmverschluss per Röntgendiagnostik ausgeschlossen wurde. Sie sollte zügig eingeleitet werden, um den Verdauungstrakt wieder in Schwung zu bringen, das Gas "voranzuschieben" und die Darmflora sowie den Kreislauf zu stabilisieren.
Wichtig: Bei einer hochgradigen Aufgasung sind in kurzen Abständen kleine Mengen zu päppeln, z. B. stündlich 3-5 ml / kg: Infolge des umfangsvermehrten Blinddarms hat der Magen kaum Platz, um sich auszudehnen. Wird er übermäßig gefüllt, entsteht ein zusätzlicher Druck aufs Zwerchfell und die großen Gefäße! Bei gering- und mittelgradigen Aufgasungen dürfen größere Mengen auf einmal gefüttert werden.
Achtung: Bei einer starken Magendilatation oder einem Darmverschluss ist auf eine Zwangsfütterung zunächst zu verzichten! Hier muss zunächst die gestörte Magenentleerung bzw. die zugrunde liegende Verstopfung behandelt werden!
Aktivkohle
Aktivkohle wirkt symptomatisch gegen Durchfall und bindet Toxine. Sie ist sinnvoll, wenn die Aufgasung von hochgradigem Durchfall begleitet wird. Die Dosierung beträgt 4-6x tgl. 1 g / kg p. o..
Kohlepräparate müssen immer mindestens 30 Minuten zeitversetzt zu anderen oralen Medikamenten verabreicht werden, da sie ihre Resorption beeinträchtigen können!
Schleimhautschutz
Ein Magen-Darm-Schleimhautschutz über mindestens 3 Wochen kommt insbesondere bei chronischen Magen- oder Darmentzündungen, wiederkehrenden Bauchschmerzen unklarer Ursache oder bei einer sehr starken Symptomatik zum Einsatz. Bewährt hat sich Bariumsulfat (2x tgl. 1 ml / kg p. o.), welches im gesamten Magen-Darm-Trakt wirkt, indem es die Schleimhäute auskleidet. Für Entzündungen im Bereich des Magens oder vorderen Dünndarms eignet sich auch Sulcralfat (z. B. Sucrabest® Granulat) in der Dosierung 2x tgl. 25 m / kg p. o..
Niemals Buscopan®!
Keinesfalls darf dem Kaninchen ein Muskelrelaxans wie Buscopan® verabreicht werden! Diese Medikamente führen zur Muskelerschlaffung, würden also den ohnehin schwach bemuskelten Darmtrakt des Kaninchens komplett lahmlegen. Gerade bei einer bereits vorhandenen Verdauungsproblematik endet dies oftmals tödlich!
 Die Tympanie bezeichnet eine Aufgasung des Magen-Darm-Traktes, insbesondere des Blinddarms, und verläuft bei ausbleibender Behandlung häufig tödlich. Aber: Eine "echte" Aufgasung kommt allerdings relativ selten vor:
Die Tympanie bezeichnet eine Aufgasung des Magen-Darm-Traktes, insbesondere des Blinddarms, und verläuft bei ausbleibender Behandlung häufig tödlich. Aber: Eine "echte" Aufgasung kommt allerdings relativ selten vor: